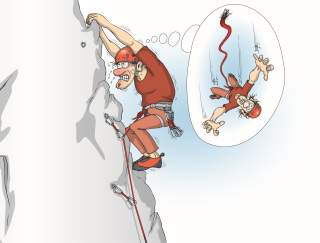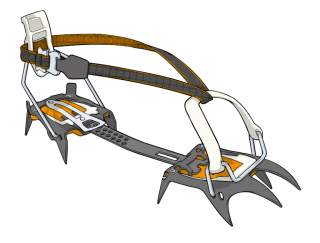Bergsport
Bergsport - für die meisten ist er mehr als "nur" Sport. Bergsport ist ein Natur- und Gemeinschaftserlebnis, bietet Nervenkitzel und Entspannung, fördert die Gesundheit und das Selbstwertgefühl. Für viele schafft diese Leidenschaft Lebenssinn, wird gar zur Lebensform. Ob Wandern, Bergsteigen, Klettern, Mountainbiken, Skitouren: Einen Einblick in die Vielfalt des Bergsports, Tipps und Infos zum Erlernen der Bergsportarten und zur Sicherheit am Berg gibt es in unserer Themenwelt.