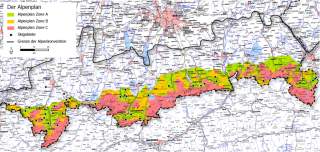Natur und Klima schützen
Wesentlicher Teil unserer Liebe zu den Bergen ist das Naturerlebnis. Als anerkannter Naturschutzverband in Deutschland und Österreich setzen wir uns für eine nachhaltige und naturverträgliche Entwicklung des Alpenraums und in den Mittelgebirgen ein. Dazu zählt die Umsetzung von Maßnahmen für einen effektiven Klimaschutz und die Förderung von naturverträglichem Bergsport. Das alles geht nur mit der Verantwortungsübernahme und Unterstützung Ehrenamtlicher. Im Folgenden finden sich weiterführende Informationen zu den Positionen und Aufgaben des DAV im Bereich Natur- und Klimaschutz.