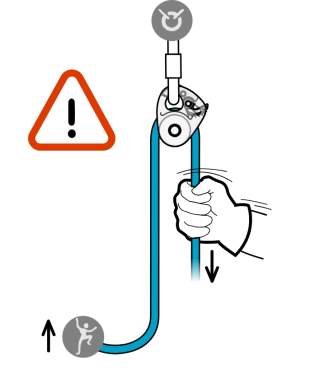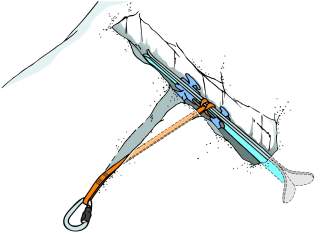Sicherheit beim Bergsport
Durch Forschung und Aufklärung versucht die Sicherheitsforschung des DAV genügend Know-How zu verbreiten, damit Bergsportler*innen eigenverantwortlich, situationsspezifisch und risikobewusst handeln können. Die Sicherheitsforschung des DAV ist ein Team aus Expert*innen, die ihre Liebe zum Bergsport, ihr wissenschaftliches Know-How und ihr technisches Studium verbunden haben, um für mehr Sicherheit in Schnee, Fels und Eis zu sorgen. Hauptberufliche Mitarbeiter*innen des DAV bilden dabei Teams mit externen Expert*innen der Bergsportsicherheit, Forschungsinstitutionen sowie Universitäten und DAV-Lehrteams.