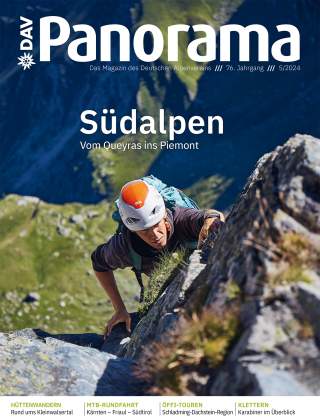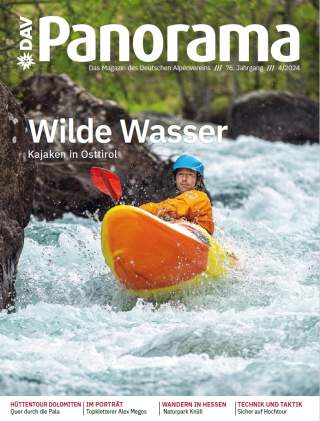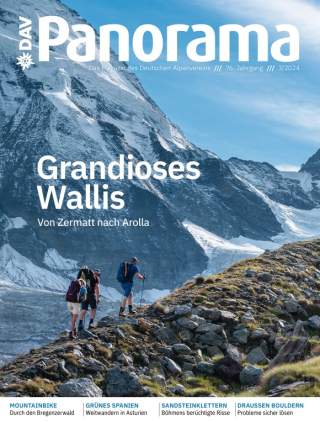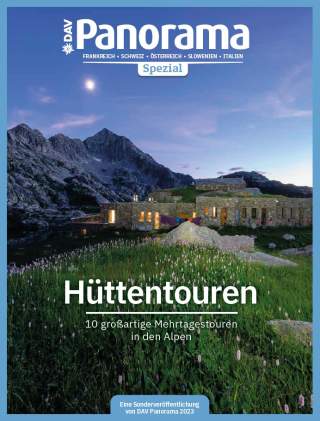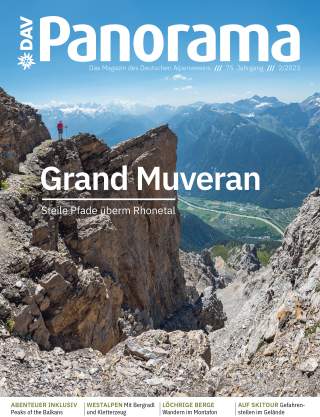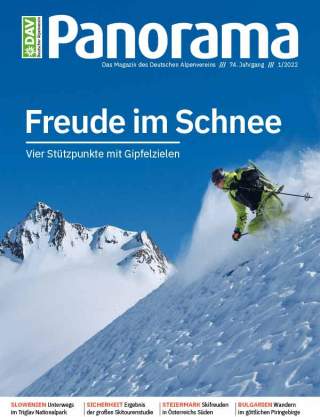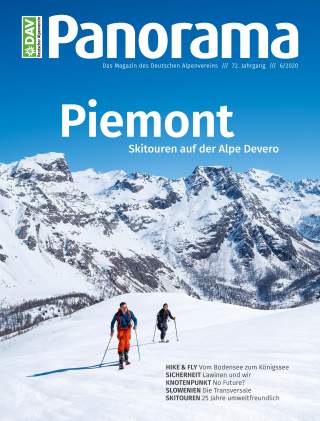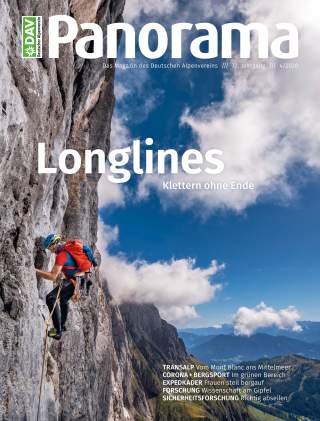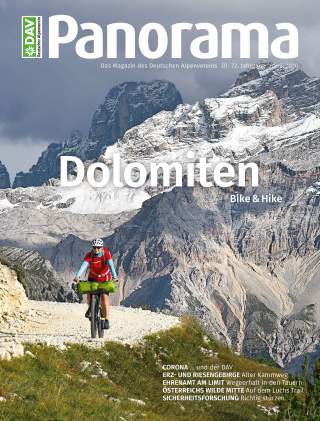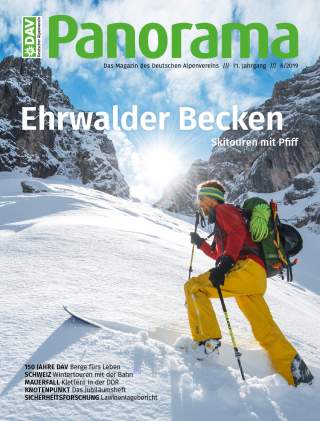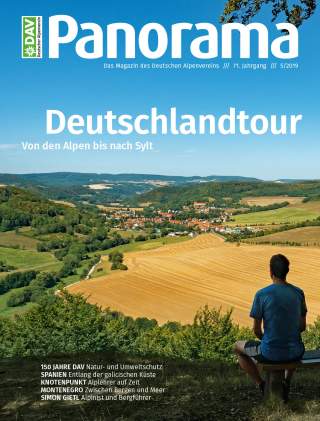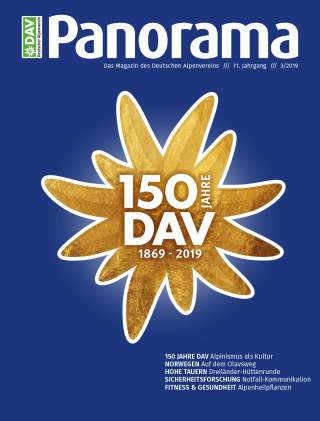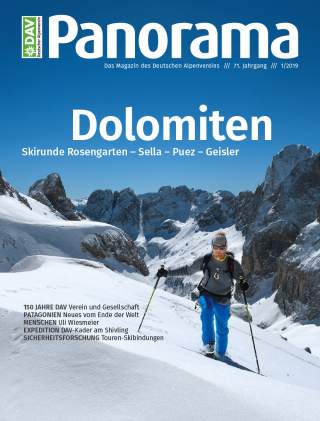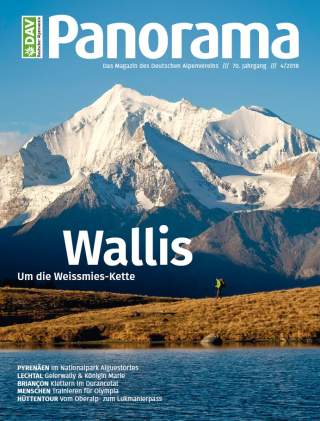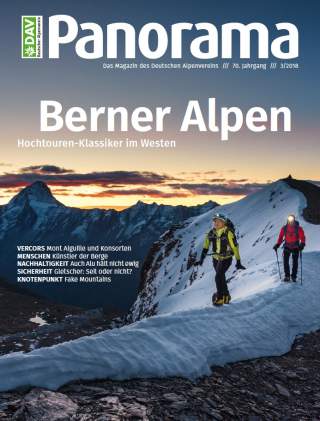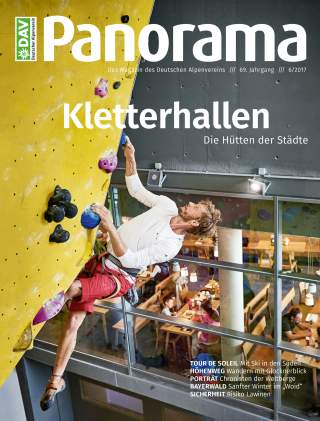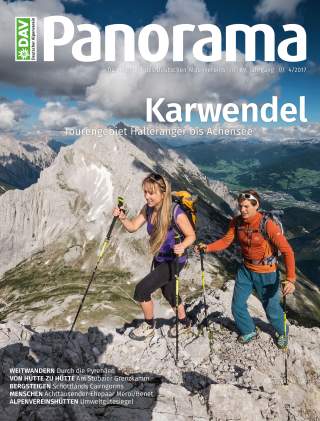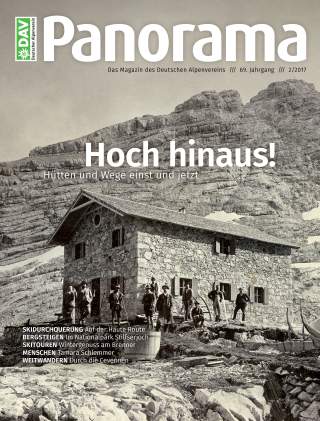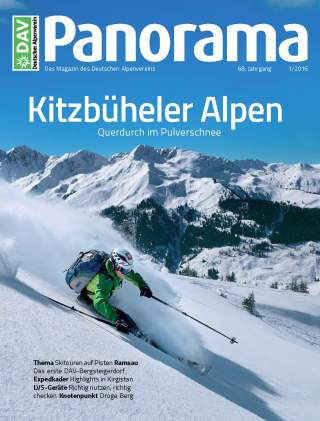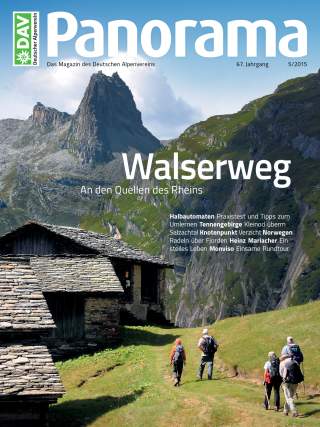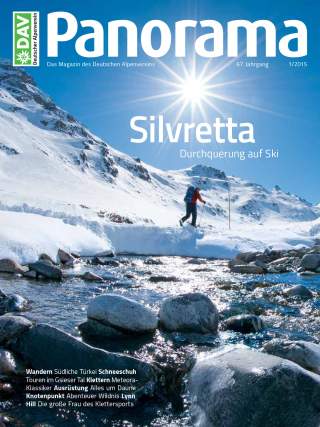Ausgaben
DAV Panorama 3/2025 – Oben sein
DAV Panorama 2/2025 - Lebensraum Berge
DAV Panorama 1/2025 – Schnee satt
DAV Panorama 6/2024 - Die erste Spur
DAV Panorama 5/2024 - Südalpen
DAV Panorama 4/2024 – Wilde Wasser
DAV Panorama 3/2024 – Grandioses Wallis
DAV Panorama 2/2024 - Im kleinsten Gang
DAV Panorama 1/2024 – Hoch hinaus
DAV Panorama 6/2023 - Lang laufen
DAV Panorama 5/2023 - Naturfotografie
DAV Panorama 4/2023 – Dauphiné
DAV Panorama Spezial Hüttentouren
DAV Panorama 3/2023 - Wunderbar wild
DAV Panorama 2/2023 – Grand Muveran
DAV Panorama 1/2023 – Bühne frei
DAV Panorama 6/2022 – Weite Horizonte
DAV Panorama 5/2022 - Familien unterwegs
DAV Panorama 4/2022 - Alta Via Alpi Biellese
DAV Panorama 3/2022 - Bergsport MTB
DAV Panorama 2/2022 - Freundschaft:...
DAV Panorama 1/2022 – Freude im Schnee
DAV Panorama 6/2021 - Einsames Graubünden
DAV Panorama 5/2021 - Klettersteig - Quo...
DAV Panorama 4/2021 - Kaunergrat
DAV Panorama 3/2021 – Große Tour
DAV Panorama 2/2021 - Südalpen
DAV Panorama 1/2021 – Auf Skitour
DAV Panorama 6/2020 - Piemont
DAV Panorama 5/2020 – Rund um Zinal
DAV Panorama 4/2020 – Longlines
DAV Panorama 3/2020 – Dolomiten Bike & Hike
DAV Panorama 2/2020 – Dachstein
DAV Panorama 1/2020 – Stubaier Klassiker
DAV Panorama 6/2019 – Ehrwalder Becken
DAV Panorama 5/2019 – Deutschlandtour
DAV Panorama 4/2019 – Glarner Alpen
DAV Panorama 3/2019 – 150 Jahre DAV
DAV Panorama 2/2019 – Rad am Berg
DAV Panorama 1/2019 – Dolomiten
DAV Panorama 6/2018 – Verwall
DAV Panorama 5/2018 – Nach oben!
DAV Panorama 4/2018 – Wallis
DAV Panorama 3/2018 – Berner Alpen
DAV Panorama 2/2018 – Piemont
DAV Panorama 1/2018 – Venedigergruppe
DAV Panorama 6/2017 - Kletterhallen
DAV Panorama 5/2017 - Pfalz
DAV Panorama 4/2017 - Karwendel
DAV Panorama 3/2017 - Dolomiten
DAV Panorama 2/2017 - Hütten und Wege
DAV Panorama 1/2017 - Ski-Transalp
DAV Panorama 6/2016 - Winter im Wandel
DAV Panorama 5/2016 - Tannheimer Tal
DAV Panorama 4/2016 - Glorreiche Sieben
DAV Panorama 3/2016 - Bergell
DAV Panorama 2/2016 - Mountainbiken
DAV Panorama 1/2016 - Kitzbüheler Alpen
DAV Panorama 6/2015 - Bregenzerwald
DAV Panorama 5/2015 - Walserweg
DAV Panorama 4/2015 - Granitgenuss
DAV Panorama 3/2015 - Ruhrgebiet
DAV Panorama 2/2015 - Alpencross
DAV Panorama 1/2015 - Silvretta
DAV Panorama 6/2014 - Dolomiten
DAV Panorama 5/2014 - Klettern
DAV Panorama 4/2014 - Karwendel
DAV Panorama 3/2014 - Wandertrilogie Allgäu
DAV Panorama 2/2014 - Rieserferner
DAV Panorama 1/2014 - Ötztaler Alpen
Auf der Suche nach älteren Panorama-Ausgaben? Hier klicken.